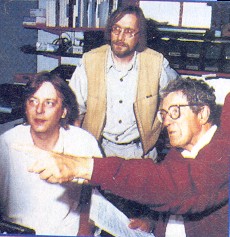"Rose, o reiner Widerspruch! Lust, niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern."
"Der nicht mehr sagbare Gott"
Eugen Drewermann hat gesagt, dass viele Menschen, die heute in Scharen die Kirche verlassen, dies nicht etwa tun, weil sie von Gott und Religion nichts mehr wissen wollen, sondern im Gegenteil, weil sie Göttliches und Spiritualität in der Kirche, wie sie nun einmal ist, vergeblich suchen. Aus genau diesem Grunde hat sich Rainer Maria Rilke von der katholischen Kirche, in deren Schoss er aufgewachsen war und sich tief geborgen gefühlt hatte, abgewandt.
Er will "keine Kirchen, welche Gott umklammern wie einen Flüchtling und ihn dann bejammern wie ein gefangenes und wundes Tier..."
So am Anfang seines Weges. Gegen Ende bezeichnet er die Kirche als "Trostmarkt", vergleicht eine protestantische Kirche mit einem "Postamt am Sonntag - reinlich und zu und enttäuscht". Er beklagt, dass die Kirche "alles tief und innig Hiesige ... ans Jenseits veruntreut hat".
Sein Leben lang kreist Rilke "um Gott, um den uralten Turm":
"Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manchesmal
in langer Nacht mit hartem Klopfen störe...
Ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen."
Aber das Wort "Gott verwendet er immer seltener. In einem frühen Gedicht ist Gott "viel tausend mal an alle Strassen gestellt". Dann - 1899 und 1900 - reist er mit Lou Andreas-Salomé nach Russland, "das mir die Brüderlichkeit und das Dunkel Gottes" schenkte. "Ich lebte lange im Vorraum seines Namens, auf den Knien." (Bei der Gelegenheit: Wenn Rilke "auf den Knien" sagt, dann meinte er das. Nichts, was er geschrieben hat, hat er nicht selber "geleistet".)
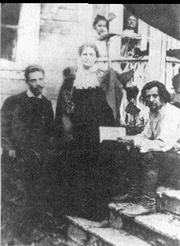
Reise nach Russland:
Rilke und Lou Andreas-Salomé mit dem Dichter
Spiridon Drozin auf dem Landgut Tolstois
Schliesslich wird Gott der "Dunkle", der "Unbekannte", der "Namenlose", der "nicht mehr Sagbare", er wagt "Ihn" nicht mehr anzureden, spricht nur noch über "den Engel" mit ihm. Der "Engel" wird eine Hauptgestalt. Die ganzen "Duineser Elegien" sind ihm hingeworfen, hingeschrien, hingefleht, hingeschleudert. An der Grösse des Engels misst er die Grösse der Welt, ringt darum, dass der Engel doch wenigstens das Grösste anerkennen möge, was Menschen geschaffen haben, vielleicht die Kathedrale von Chartres, wenigstens die Liebe eines liebenden Mädchens, aber dann erkennt er: Alle menschliche Grösse ist "klein vor dem Himmel", würde "vergehen vor seinem stärkeren Dasein".
Versteht sich, dass er nicht die "behübschten" Engelchen des Rokoko mit Pausbacken und Schmetterlingsflügeln meint: "Ein jeder Engel ist schrecklich."
Rilke fordert, was immer mehr Menschen des Neuen Bewusstseins begreifen: "Glaube, dieser Zwang zu Gott, hat keinen Platz, wo einer mit der Entdeckung Gottes begonnen hat ... Erst muss man Gott erfahren ... Ich habe ein unbeschreibliches Vertrauen zu jenen Völkern, die nicht durch Glaube an Gott geraten sind ... Den anderen aber ist Gott ein Abgeleitetes ..., darum entgleiten ihre Religionen so leicht ins Moralische - während ein ursprünglich erfahrener Gott Gut und Böse nicht sondert ..."
Er habe, sagt Rilke, eine "beinahe rabiate Antichristlichkeit". Ich glaube, es war das einzige Mal in seinem Leben, dass er - dieser milde Mensch! - das Wort "rabiat" gebraucht hat. Also: Kraft war ihm nötig für diesen Akt des Sich-Wehrens. Denn der christliche Gott ist ständig gegenwärtig in ihm und in seinem Werk. Dutzende von Gedichten über Christus, ein ganzer Zyklus über die Gottesmutter - von Empfängnis und Geburt bis Kreuzestod und Auferstehung! "Lasst uns endlich das Erlöstsein antreten", das uns das Christentum verspricht, fordert er ungeduldig. Und an anderer Stelle: "Mehr und mehr kommt das christliche Erlebnis ausser Betracht, der uralte Gott überwiegt es unendlich."

Seine letzte Ruhestätte fand Rainer Maria Rilke in Raron,
Schweiz. Auf dem Grabstein die "tiefsten Worte,
die je über Rosen geschrieben wurden"
Irgendwann auf diesem Wege streift er Buddha - streift ihn nur gerade - und feiert ihn "in der Glorie":
"Mitte aller Mitten, Kern der Kerne...
In dir ist schon begonnen,
was die Sonnen übersteht."
"Denn des Anschauens, siehe, ist eine Grenze...
Werk des Gesicht's ist getan,
tue nun Herz-Werk
an den Bildern in dir, jenen gefangenen..."
![]()
Rilke bezieht sich auf Luther, für den der Mensch "unmittelbar zu Gott" ist. Deshalb schaffte der Reformator Gottesmutter, die Heiligen, den Papst, Bischöfe und Beichtväter ab. Rilke geht noch einen Schritt weiter: Er empfindet auch Christus als - schockierender Ausdruck! - "Verdecker Gottes".
Gott ging ihm, je älter er wurde, über ins "Reine Sein". Ins "Offene" - bis Er darin verschwand. Wie in den Lehren - in der Leere! - der indischen Weisen. Aber er kannte die indische Überlieferung nicht, war ganz und gar Abendländer, hatte den "vedischen Weg" selber entdeckt und erfahren.
|
Das "unsägliche Land" lauschend "säglich" machen
Prof. Joachim-Ernst Berendt über die Arbeit an einer Rilke-CD, die den Anlass bildete für das Entstehen des nebenstehenden Essays: Während der Arbeit an der Rilke-Platte* erfuhr ich - auswählend, zusammenfügend, sprechend, Philip Catherine, Vladislav Sendecki und Krzysztof Zgraja - diese wunderbaren Musiker! - anregend, das Entstehen ihrer Musik miterlebend, schliesslich Musik und Sprache zusammenfügend, ihren Zusammenklang erfahrend (all dies ein monatelanger Prozess) -, dass Rilkes "Seelenlandschaften" - das Tal des Todes, das "letzte Gehöft von Gefühl", die Berge des Herzens, der "kleine Kirchhof mit seinen klagenden Namen", die "verschweigende Schlucht", die "letzte Ortschaft der Worte", der reine "Widerspruch" der Rose und ihrer vielen Augelider, das "steil vor dem Herzen" stehende Gestein, die Nacht im Gebirg der Gefühle, "Lager und Genist" im Wald, der "Tau von dem Frühgras", die "Welle, deren allmähliches Meer ich bin", die fallenden Blätter und die letzten Früchte des Herbstes ... dass all diese Landschaften erhört werden wollen und können. Lauschend können wir es "säglich" machen - dieses "unsägliche Land" jenseits des Anschauens - diesseits der Stille. So haben wir Krzysztof Zgrajas Musik zu Texten aus den "Duineser Elegien" hineingespannt in ein sechsstimmiges Flötengeflecht, an dessen Anfang ein Schrei der Verzweiflung steht ("Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn") - aber dieser Schrei wird im Lauf des Stückes zur Keimzelle eines Lobgesanges ("Hiersein ist herrlich"). So ersteigt Zgrajas Flöte zu Rilkes "Bergen des Herzens" wirklich ein Gebirge - immer höher und höher -, Ausschau haltend da oben, lauschend in immer dünner werdender Luft - auf der Basis eines gregorianischen Chorals, über der sich Vogelrufe und Wehen des Windes, die Feier und das Leuchten des "Seins" erheben. Zu Rilkes Gedichten vom "Traum" identifiziert sich Zgraja so sehr mit Rilkes Visionen, als sei er der alte chinesische Weise Tschuang, dem einst träumte, er sei ein Schmetterling und flatterte von Blüte zu Blüte; dann aber erwachte er, und nun war er wieder Tschuang. "Jetzt aber weiss ich nicht: Bin ich ein Mensch, dem geträumt hat, er sei ein Schmetterling? Oder ein Schmetterling, dem träumte, er sei Tschuang? Aber dann zerreissen beide - Rilke und Zgraja - den Traum. Denn: "Wachsein ist anderswo." Und Vivaldi erklingt! In der Musik schwingt, wie ich es bei meinen Platten liebe, "Musik der ganzen Welt": Meditatives und Gregorianik, Jazziges und Indisches, Johann Sebastian Bach, Mozart und Schubert, christliche Choräle und die buddhistische Gaccami-Hymne der Hingabe... Ich habe versucht, Rilkes Gedichte "hörend" zu sprechen. Ihr "Übermass an Musik" (von dem Stefan Zweig sprach) zu er-lauschen. Es sprechend zu ertasten. Paul Célan - der andere grosse deutsche Dichter dieses Jahrhunderts, Rilke in tiefer Weise verwandt - hat einmal geraten: "Hör dich ein mit dem Mund." Ich möchte den Rat Célans an die Hörerin, den Hörer meiner CD weitergeben. Rilke ist ein Abenteuer für Zunge, Mund und Gaumen. Sprechen Sie die Sätze Rilkes, die Sie betreffen (oder von denen Sie möchten, dass die Sie betreffen!) laut: Nirgends wird Welt sein als innen ... Wer zuviel begreift, dem geht das Ewige vorbei ... Hiersein ist herrlich ...Du musst dein Leben ändern ... Wolle die Wandlung ... Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält ... Erkunden Sie Rilkes "unendliche Landschaft der Worte" sprechend und Ihrem eigenen Sprechen nachlauschend. Ihr Mund wird es geniessen wie eine kostbare Speise und weitergeben an jede Zelle. Und an Ihr Herz. _______________________ *CD "Seelenlandschaften", DM 38,- (MC DM 26,-), Bauer Musikverlag im Verlag Hermann Bauer, Freiburg 1997
Joachim-Ernst Berendt (re.) mit dem Produzenten Horst Bösing (links) und dem Flötisten Krzystof Zgraja |